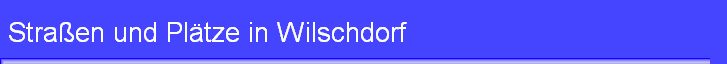 |
|
Der Altwilschdorfer Weg verbindet den Wilschdorfer Ortskern in Richtung Norden mit dem benachbarten Volkersdorf und dem Oberen Waldteich. Bereits um 1890 wurde er im Volksmund Sandweg genannt. Amtlich galt diese Straßenbezeichnung jedoch erst nach 1945. Um Verwechslungen mit dem Sandweg in Loschwitz zu vermeiden, erfolgte im August 1962 die Umbenennung in Altwilschdorfer Weg. Unmittelbar an der Stadtgrenze zweigt von ihm der Volkersdorfer Sandweg ab. Die Straße Am Buscherberg im Süden von Wilschdorf trug ursprünglich wegen ihrer Lage am Rand des Elbtalkessels den Namen Am Hang. Da es nach der Eingemeindung von Mobschatz diesen Namen jedoch doppelt gab, erfolgte im Februar 1993 die Umbenennung in Am Buscherberg. Die Namensgebung ist vom Flurstück "Buscher-Berge" abgeleitet. Dieses ist auch der Namensgeber des Buscherberggrabens, einem kleinen Nebenbach des Pfarrbuschgrabens. Die Straße Am Sportplatz liegt in der südlich des alten Dorfkerns gelegenen Siedlung und erhielt ihren Namen Anfang der 1940er Jahre. Damals befand sich auf dem Areal Am Sportplatz / Am Weinberg ein heute nicht mehr genutzter Sportplatz. Die teilweise als Straße, teilweise als Fußweg ausgebaute Straße Am Weinberg befindet sich ganz im Süden der Ortsflur. Der 1928 amtlich eingeführte Straßenname erinnert an den bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in den Trachenbergen betriebenen Weinbau und führt von der Radeburger Straße bis zum Boxdorfer Weg. Sonnenhof (Nr. 45): Die Geschichte der Begegnungsstätte "Sonnenhof" begann im Jahr 1927, als die christliche Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten hier ein Grundstück erwarb. Am 31. Oktober 1927 wurde der erste Gottesdienst, damals noch im Freien, abgehalten. Ein Jahr später entstand eine einfache Baracke mit Küche, Gemeinschafts- und Schlafräumen, die als Erholungs-, Veranstaltungs- und Tagungsstätte diente. Ziel war es, zum einen jungen Menschen eine gesunde Aufenthaltsmöglichkeit zu gewähren und zugleich den Gemeindemitgliedern eine Begegnungsstätte für Wochenenden und die Freizeit zu schaffen. Fortan fanden hier Kindererholungszeiten, Jugendveranstaltungen und Tagungen für ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter statt.
Zu den Höhepunkten des kirchlichen Lebens gehörte die große Evangelisation mit B. Thorp aus den USA im Herbst 1990. Mehrere Wochen wohnten zahlreiche Prediger und ihre Mitarbeiter auf dem Sonnenhof, um hier ihre Ausbildung zu erhalten. Wegen des drastischen Rückgangs der Besucherzahlen vermietete die Gemeinde das Haus später an Montagearbeiter, bevor im Jahr 2000 eine umfassende Sanierung begann. Heute werden die Räume für Hochzeiten, Familienfeiern und an Urlaubsgäste, aber auch für Tagungen, Bibel- und Begegnungswochen vermietet. Die Straße Am Winkel liegt südlich des alten Dorfkerns und wurde im 19. Jahrhundert im Volksmund als Froschgasse bezeichnet. Vermutlich waren sumpfige Flächen in der Nähe Ausgangspunkt dieser Bezeichnung. Da die kleine Straße in einem winkelartigen Knick verläuft, erhielt sie bei der Erstbenennung der Wilschdorfer Straßen 1923 ihren heutigen Namen Am Winkel. Von den älteren Wohnhäusern der Straße steht das Haus Am Winkel 4 unter Denkmalschutz. Der Amselweg entstand im Zuge des Baus einer Wohnsiedlung an der Keulenbergstraße und zweigt als Sackgasse von der Waldteichstraße ab. Seit 1933 wurde er zunächst Kurzer Weg genannt. Um Verwechslungen mit einer gleichnamigen Straße in Hellerau zu vermeiden, erhielt er im September 1953 den Namen Amselweg. Zuvor gab es mit dem Elsternweg bereits eine weitere nach einer Vogelart benannte Straße in diesem Viertel. Die Straße An der Jungen Heide ist erst seit März 1996 benannt, als der zuvor namenlose Weg zur Erschließung eines neuen Wohngebietes östlich der Einmündung der Waldhofstraße in den Lößnitzweg ausgebaut wurde. Der Name nimmt Bezug auf das angrenzende Waldgebiet Junge Heide. Die Berggasse führt im Süden der Wilschdorfer Flur von der Waldhofstraße in Richtung Osten ab und wurde bereits im 19. Jahrhundert erwähnt. Bedeutendstes Anwesen ist das um 1750 entstandene Areal "Glasewalds Ruhe" mit dem Landhaus des früheren Wilschdorfer Pfarrers Jonathan Glasewald (1707-1768). In den 1930er Jahren wurde der unmittelbar am Grundstück verlaufende Abschnitt des Weges ebenfalls Glasewalds Ruhe genannt, nach 1945 jedoch in die Berggasse einbezogen.
Der zur Erschließung einer Wohnsiedlung im südlichen Teil von Wilschdorf angelegte Elsterweg ist 1943 erstmals im Adressbuch zu finden. Die Namensgebung nach einer Vogelart wurde später auch für einige Nachbarstraßen wie den Amselweg, den Taubenweg und den Habichtweg übernommen. Die Ernst-Wagner-Straße liegt im westlichsten Teil der Wilschdorfer Flur und bildet hier zugleich die Dresdner Stadtgrenze zum Moritzburger Ortsteil Boxdorf, zu dem auch die meisten Grundstücke gehören. Ursprünglich wurde sie ab 1928 nach dem Flurstück "Otteritze" Otteritzweg genannt. 1934 erhielt die Straße den Namen des nationalsozialistischen Kämpfers Albert Leo Schlageter. Unmittelbar nach Kriegsende hob man diese Namensgebung im Mai 1945 wieder auf. Im Haus Otteritzweg 20 lebte viele Jahre der Boxdorfer Bürgermeister Ernst Wagner (1880-1954). Ihm zu Ehren wurde der Otteritzweg ein Jahr nach seinem Tod in Ernst-Wagner-Straße umbenannt. Der Gartenweg entstand Mitte der 1930er Jahre im Zuge des Ausbaus der Siedlung zwischen Leeraue und Radeburger Straße und erhielt 1936 seinen Namen nach den dort befindlichen Gärten. Der Gassenweg zweigte einst im Ortskern an der heutigen Warnemünder Straße ab,und führte von dort südwestlich am Oberen Waldteich vorbei nach Moritzburg. An diesem Weg lag auch die im Mittelalter zur Wüstung gewordene Siedlung Cunnersdorf. Im 19. Jahrhundert ist er als Moritzburger Straße in den Karten verzeichnet, nach 1900 dann als Gassenweg. Amtlich benannt wurde er jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Im weiteren Verlauf jenseits der Stadtgrenze wird er heute Alte Dresdner Straße genannt. Teile des Gassenweges fielen nach 1990 der Anlage des Gewerbegebietes von AMD / Globalfoundries zum Opfer, so dass er heute erst an der Wilschdorfer Landstraße beginnt. Die Großröhrsdorfer Straße entstand Ende der 1920er Jahre beim Bau einiger Wohnhäuser und wurde zunächst Kurzer Weg genannt. 1933 übertrug man diese Bezeichnung auf den heutigen Amselweg und benannte sie nach dem deutschen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (1847-1934) in Hindenburgstraße um. Ab Juni 1945 wurde sie nach dem KPD-Politiker Ernst Thälmann (1886-1944) Ernst-Thälmann-Straße genannt. Um Verwechslungen mit gleichnamigen Straßen in anderen Stadtteilen zu vermeiden, erfolgte nach der Eingemeindung von Wilschdorf im September 1953 eine erneute Umbenennung in Großröhrsdorfer Straße. Namensgeber ist die durch ihre Textilindustrie bekannt gewordene Stadt Großröhrsdorf in der Oberlausitz.
Der Habichtweg in der Siedlung südlich des Dorfkerns verläuft parallel zu den ebenfalls nach Vogelarten benannten Straßen Taubenweg und Elsternweg. Zunächst blieb er wegen der fehlenden Bebauung ohne Namen und wurde erst im November 1995 offiziell benannt. Der kleine Weg Im Pfarrbusch war eine Seitenstraße des Gartenwegs und ist in älteren Stadtplänen, so z.B. 1954 verzeichnet. Die Namensgebung erfolgte nach der Flurbezeichnung Pfarrbusch, die auch Namensgeber des in der Nähe entspringenden Pfarrbuschgrabens und der Pfarrbuschteiche ist. Heute ist dieser Weg nicht mehr vorhanden.
Ende des 19. Jahrhunderts entstanden an der Keulenbergstraße außerhalb des Dorfkerns die ersten Arbeiterwohnhäuser. Das markante Eckhaus zur Saßnitzer Straße (Nr. 34) beherbergte viele Jahre die Gaststätte "Wilschdorfer Höhe" und wird heute von einer Bäckerei mit angeschlossenem Café genutzt (Fotos von ca. 1950 und 2019).
Der Kunzer Marktweg ist ein alter Fußweg, der am Ausgang des Dorfes vom Sandweg (Altwilschdorfer Weg) in westlicher Richtung abging und zur Wüstung Cunnersdorf führte. Der auch Kummersdorf genannte Ort ist bereits 1408 als "wüste Mark" genannt und lag westlich der Waldteiche in der Nähe der Dresdner Stadtgrenze. Vermutlich wurde aus dem Begriff "wüste Mark Cunnersdorf" die Benennung Kunzermarkweg abgeleitet. Später wechselte die Schreibweise in Kunzer Markweg und wurde nach 1945 in das eigentlich falsche Kunzer Marktweg geändert. Durch den Bau des Gewerbegebietes ist der Kunzer Marktweg heute nur noch in Teilabschnitten erhalten. Ein kurzer Abschnitt zweigt heute noch auf Dresdner Stadtgebiet von der Wilschdorfer Landstraße ab und führt am nordwestlichen Teil des Wilschdorfer Gewerbegebietes entlang. Ein größerer Teil verläuft als Straße mit diesem Namen entlang des Gewerbegebietes von Moritzburg.
Das Straßenbild prägen heute hauptsächlich Ein- und Mehrfamilienhäuser aus den 1920er und 1930er Jahren. Auf dem Grundstück Nr. 10 steht eine als Naturdenkmal eingetragene Säulen-Pappel. Im Haus Leeraue 59 befindet sich seit einigen Jahren das Apartment-Hotel "Alter Weinberg". Pfarrbuschgraben: In der Nähe der Leeraue, zwischen dieser Straße und dem Ruheweg entspringt der Pfarrbuschgraben, ein weitgehend naturbelassenes Gewässer, welches von dort in Richtung Junge Heide fließt. Seinen Namen erhielt es nach dem früher in kirchlichem Besitz befindlichen Grundstück Pfarrbusch, das sich bis zu "Glasewaldts Ruhe" erstreckt. Nach dem Zufluss zweier weiterer Bäche speist der Pfarrbuschgraben die beiden Pfarrbuschteiche und verläuft von dort in Richtung Lößnitzweg. Dort münden der Lößnitz- und der Waldesruhgraben, wenig später noch der Buscherberggraben. Trotz seiner zahlreichen kleinen Zuflüsse führt der Pfarrbuschgraben zu wenig Wasser, um das Elbtal zu erreichen, sondern versickert im sandigen Boden der "Jungen Heide". Aus diesem Grund wird er auch "Verlorenes Wasser" genannt.
Historisch interessant ist das unter Denkmalschutz stehende Bähnsch-Kutsch-Gut (Nr. 2), einer der am besten erhaltenen Wilschdorfer Bauernhöfe (Foto). Der Mühlweg ist Teil einer Querverbindung zwischen der nördlichen und südlichen Trasse des alten Bischofsweges und wurde bereits im 12. Jahrhundert erwähnt. Dieser Weg führte durch die Fluren von Klotzsche, Rähnitz und Wilschdorf und wurde meist als Querweg bezeichnet. In Wilschdorf war im 19. Jahrhundert auch die Bezeichnung Hauptweg üblich. Im Zuge des Ausbaus dieses Weges zur Fahrstraße führten die Gemeinden unterschiedliche Straßennamen ein. In Klotzsche wurde er zur Querallee (heute Boltenhagener Straße), in Rähnitz-Hellerau zur Klotzscher Straße (heute Ludwig-Kossuth-Straße) und in Wilschdorf 1923 zur Reichenberger Straße (heute Saßnitzer Straße). Der Abschnitt zwischen Leeraue und Ortsgrenze zu Boxdorf bekam den Namen Mühlweg. Ausgangspunkt für diese Benennung war die einstige Nutzung des Wegs zum Mahlen des Getreides in der Hermsdorfer Schloßmühle bzw. der Boxdorfer Windmühle. Der Oltersteinweg ganz im Süden von Wilschdorf erhielt seinen Namen 1934. Namensgeber waren die sagenumwobenen Oltersteine in der Dresdner Heide, ein Naturdenkmal ganz in der Nähe. Die Radeburger Straße führt in Verlängerung der Hansastraße über Trachenberge und Wilschdorf zur Stadtgrenze und von dort weiter in Richtung der Kleinstadt Radeburg. 1897 erhielt die Landstraße amtlich diesen Namen. Im Zuge des Autobahnbaus Mitte der 1930er Jahre wurde sie als Zubringerstraße ausgebaut und erhielt zusammen mit der Hansastraße im September 1942 den Namen Dr.-Todt-Straße. Fritz Todt (1891-1942) war Generalinspekteur des Straßenbauwesens und Leiter des NS-Autobahnprojektes. 1942 kam er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Am 27. September 1945 wurden beide Straßen rückbenannt.
Der Ruhesteg, früher auch Ruhesteig genannt, verbindet den Mühlweg mit der Berggasse. Das hier gelegene Grundstück "Glasewaldts Ruhe" war Auslöser dieser Namensgebung. Die heutige Saßnitzer Straße ist ein Teilstück des früheren Querweges, der einst von Wilschdorf über Rähnitz nach Klotzsche führte und schon im 12. Jahrhundert erwähnt ist. 1923 erhielt der östlich der Straße Leeraue gelegene Abschnitt bis zur Hellerauer Flurgrenze den Namen Reichenberger Straße. Namensgeber war der Ort Reichenberg, heute ein Ortsteil von Moritzburg. Um Verwechslungen mit der Reichenberger Straße in Trachau zu vermeiden, erfolgte im September die Umbenennung in Saßnitzer Straße. Die Namensgebung folgt einer nach 1945 begründeten Tradition, Straßen im Norden der Stadt nach Orten im Ostseegebiet zu benennen. Der Taubenweg entstand Anfang der 1960er Jahre im Zusammenhang mit der Erweiterung des Wohngebietes zwischen Leeraue und Keulenbergstraße. Wie auch beim benachbarten Habicht- und Elsternweg erfolgte die Benennung nach einer Vogelart. Amtlich gilt der Straßenname seit dem 15. August 1962. Der sogenannte Viehweg führt von der Straße Am Winkel zum Mühlweg und wurde einst zum Treiben des Viehs genutzt. In verschiedenen älteren Stadtplänen, so 1989, ist er als Viehweg eingetragen. In jüngeren Plänen taucht die Bezeichnung nicht mehr auf, der Weg ist jedoch noch vorhanden. Der Volkersdorfer Sandweg ist ein Abzweig des früheren Sandweges, der heute offiziell als Altwilschdorfer Weg bezeichnet wird. Der seit 2000 ausgewiesene Weg führt zum Zeltplatz und Strandbad am Oberen Waldteich. Die Waldhofstraße wurde Ende der 1920er Jahre nach dem Gebäudeensemble Waldhof benannt, das zu dieser Zeit als Kindererholungsheim diente. An der Waldhofstraße befindet sich auch das heute unter dem Namen "Waldmax" bekannte Ausflugslokal "Cafe Waldesruh" (Nr. 26). Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Waldhof: Das Grundstück wurde 1625 erstmals als “Weinbergstede” erwähnt, als Kurfürst Johann Georg I. dieses Anwesen dem Markscheider Balthasar Zimmermann überließ. Spätere Besitzer bauten die Gebäude mehrfach um, bevor 1884 der Bauunternehmer und Bildhauer Peter Henseler das Grundstück erwarb. Dieser ließ die noch heute vorhandenen Plastiken an der Einfahrt aufstellen. In dieser Zeit erhielt das Haus den Namen “Waldhof”, der auch der vorbeiführenden Straße den Namen gab. 1922 kaufte der Dichter Carl Sternheim den Waldhof und bewohnte das Haus gemeinsam mit seiner Frau Thea und seinen beiden Kindern. Sternheim, Verfasser zahlreicher gesellschaftskritischer Dramen, traf sich hier regelmäßig mit seinen Künstlerfreunden, unter ihnen der Maler Conrad Felixmüller, der Dichter Walter Hasenclever und der Verleger Jakob Hegner. Auch der sozialistische Politiker und Agitator Otto Rühle gehörte zum Freundeskreis des Paares. Im Oktober 1924 verzog das Ehepaar Sternheim an den Bodensee, womit dieses Kapitel Dresdner Kulturgeschichte endete. Ab 1929 wurde das Gebäude als Kindererholungsheim der Sächsischen Landesversicherungsanstalt genutzt, in den 1930er Jahren auch als privates Frauenbildungsseminar. Während des Zweiten Weltkriegs diente der Waldhof als Notkrankenhaus. Nach 1945 wurde das Haus wieder Kinderheim und diente ab 1967 als Rehabilitationszentrum. Künftig ist der Ausbau zu einer Wohnanlage geplant.
Gasthof Wilschdorf: Der Gasthof Wilschdorf an der heutigen Warnemünder Straße wurde erstmals 1242 erwähnt. Das heutige Gebäude mit seinem Saalanbau entstand im 19. Jahrhundert. 1942 wurde in den Saal eine wertvolle Kassettendecke eingebaut, die beim Abbruch des Schlosses von Altfranken geborgen worden war. Der 2002 geschlossene und danach viele Jahre leerstehende Gasthof dient seit seinem Umbau 2008 als Firmensitz eines Bühnentechnik-Unternehmens. Zu den jüngsten Straßen in Wilschdorf gehört die nördlich des Dorfes vorbeiführende Wilschdorfer Landstraße. Diese entstand erst in den 1990er Jahren als Zufahrt zum neuen Autobahnanschluss Dresden-Flughafen und erschließt zugleich die beiden Gewerbegebiete in Wilschdorf und Rähnitz. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung dieses Gebietes verschwanden auch einige historische Wegführungen bzw. wurden verändert. So wurden Teile des Gassenweges und des Kunzer Marktweges überbaut, der Altwilschdorfer Weg (ehem. Sandweg) verkürzt und ein Abschnitt des Grutzschgenweges als Zufahrt zum Ort ausgebaut. Die kleine Straße Zum Oberen Waldteich bildet die Grenze zwischen Wilschdorf und dem benachbarten Volkersdorf und ist somit zugleich Dresdner Stadtgrenze. Die in vielen Stadtplänen nicht namentlich ausgewiesene Straße erhielt ihren Namen nach dem als Bade- und Erholungsort beliebten Oberen Waldteich.
Foto: Das Bad Volksgesundheit Oberer Waldteich in den 1930er Jahren
|
| [Home] [Nord] [Nordwest] [Neustadt] [Nordost] [West] [Zentrum] [Südwest] [Süd] [Südost] [Ost] [Register] [Kontakt] [Impressum] |
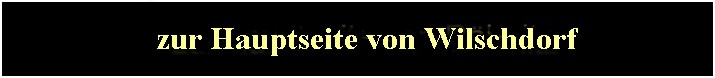
 Als Altwilschdorf wird heute die frühere Hauptstraße des Dorfes bezeichnet. Zunächst inoffiziell Dorfstraße bzw. Breite Gasse genannt, wurde im Juli 1923 offiziell der Name Dorfstraße eingeführt. Drei Jahre später erfolgte der Namenswechsel in Hauptstraße. Eine erneute Umbenennung war nach der Eingemeindung des Ortes 1950 notwendig, da es bereits im nahen Klotzsche eine Hauptstraße gab (heute Klotzscher Hauptstraße). Dabei entschied man sich 1953 zunächst für den Namen Senftenberger Straße, änderte diesen jedoch später in Altwilschdorf.
Als Altwilschdorf wird heute die frühere Hauptstraße des Dorfes bezeichnet. Zunächst inoffiziell Dorfstraße bzw. Breite Gasse genannt, wurde im Juli 1923 offiziell der Name Dorfstraße eingeführt. Drei Jahre später erfolgte der Namenswechsel in Hauptstraße. Eine erneute Umbenennung war nach der Eingemeindung des Ortes 1950 notwendig, da es bereits im nahen Klotzsche eine Hauptstraße gab (heute Klotzscher Hauptstraße). Dabei entschied man sich 1953 zunächst für den Namen Senftenberger Straße, änderte diesen jedoch später in Altwilschdorf.
 Bis heute sind hier zahlreiche ehemalige Bauernhöfe zu finden, die jedoch meist nur noch Wohnzwecken dienen bzw. gewerblich genutzt werden. Im Haus Nr. 4 befindet sich der traditionsreiche Gasthof "Zum alten Graf" mit seinem Biergarten (Foto rechts). Das Lokal ging 1883 aus der früheren Dorfschmiede hervor und verdankt seinem Namen dem damaligen Besitzer, dem Dorfschmied Graf. 1949 zunächst geschlossen wird es seit einigen Jahren wieder gastronomisch genutzt.
Bis heute sind hier zahlreiche ehemalige Bauernhöfe zu finden, die jedoch meist nur noch Wohnzwecken dienen bzw. gewerblich genutzt werden. Im Haus Nr. 4 befindet sich der traditionsreiche Gasthof "Zum alten Graf" mit seinem Biergarten (Foto rechts). Das Lokal ging 1883 aus der früheren Dorfschmiede hervor und verdankt seinem Namen dem damaligen Besitzer, dem Dorfschmied Graf. 1949 zunächst geschlossen wird es seit einigen Jahren wieder gastronomisch genutzt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es, ein festes Gebäude zu errichten. Das zweistöckige Haus entstand nach Plänen des Architekten Franz, der kurz zuvor auch das Adventshaus der Gemeinde auf der
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es, ein festes Gebäude zu errichten. Das zweistöckige Haus entstand nach Plänen des Architekten Franz, der kurz zuvor auch das Adventshaus der Gemeinde auf der  Glasewaldts Ruhe: Das seit 1885 als Gaststätte genutzte Grundstück erhielt seinen Namen nach dem Ruhesitz des Wilschdorfer Pfarrers Jonathan Glasewaldt (1707-1768), der dieses Amt zwischen 1739 und 1762 innehatte. Glasewaldt hatte hier um 1750 im sogenannten "Pfarrbusch" einen kleinen Rastplatz angelegt und später noch um ein Weingut erweitert. Mit seinem Umzug nach Lausa übergab er das Anwesen seinem Bruder Friedrich, der zwischen 1771 und 1783 Dresdner Bürgermeister war.
Glasewaldts Ruhe: Das seit 1885 als Gaststätte genutzte Grundstück erhielt seinen Namen nach dem Ruhesitz des Wilschdorfer Pfarrers Jonathan Glasewaldt (1707-1768), der dieses Amt zwischen 1739 und 1762 innehatte. Glasewaldt hatte hier um 1750 im sogenannten "Pfarrbusch" einen kleinen Rastplatz angelegt und später noch um ein Weingut erweitert. Mit seinem Umzug nach Lausa übergab er das Anwesen seinem Bruder Friedrich, der zwischen 1771 und 1783 Dresdner Bürgermeister war.
 Zwischen 1900 und 1918 wurde das Gebäude als Militärgenesungsheim des XII. Sächsischen Armeekorps genutzt, danach wieder als Gaststätte und Tanzlokal. 1932 entstand auf dem Areal ein kleines Bad. Die Gaststätte wurde nach 1945 geschlossen und in ein staatliches Gästehaus des Rates des Bezirkes Dresden umgewandelt, wofür umfangreiche Erweiterungsbauten entstanden.Regelmäßig war das Haus auch Mannschaftsquartier von Dynamo Dresden vor wichtigen Auswärtsspielen. Seit Schließung des Gästehauses 1992 steht der Komplex leer.
Zwischen 1900 und 1918 wurde das Gebäude als Militärgenesungsheim des XII. Sächsischen Armeekorps genutzt, danach wieder als Gaststätte und Tanzlokal. 1932 entstand auf dem Areal ein kleines Bad. Die Gaststätte wurde nach 1945 geschlossen und in ein staatliches Gästehaus des Rates des Bezirkes Dresden umgewandelt, wofür umfangreiche Erweiterungsbauten entstanden.Regelmäßig war das Haus auch Mannschaftsquartier von Dynamo Dresden vor wichtigen Auswärtsspielen. Seit Schließung des Gästehauses 1992 steht der Komplex leer.
 Der Grutzschgenweg wurde bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Gemeindeakten genannt und verband die Radeburger Straße mit der Dorfstraße (Altwilschdorf). Der Begriff "Grutzschgen" bzw. "Krutschken" stammt aus dem Slawischen und bezeichnet Felder oder Ackerstücke. Amtlich eingeführt wurde die Straßenbezeichnung in den 1950er Jahren. Am Grutzschgenweg liegen auch ein kleiner Teich sowie das Flurstück Ellerwiesen, welches sich bis zur Radeburger Straße erstreckt. Nach dem Bau des Gewerbegebietes und des neuen Autobahnzubringers wurde die Bezeichnung Grutzschgenweg auch auf die nördliche Verlängerung der Straße Altwilschdorf übertragen.
Der Grutzschgenweg wurde bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Gemeindeakten genannt und verband die Radeburger Straße mit der Dorfstraße (Altwilschdorf). Der Begriff "Grutzschgen" bzw. "Krutschken" stammt aus dem Slawischen und bezeichnet Felder oder Ackerstücke. Amtlich eingeführt wurde die Straßenbezeichnung in den 1950er Jahren. Am Grutzschgenweg liegen auch ein kleiner Teich sowie das Flurstück Ellerwiesen, welches sich bis zur Radeburger Straße erstreckt. Nach dem Bau des Gewerbegebietes und des neuen Autobahnzubringers wurde die Bezeichnung Grutzschgenweg auch auf die nördliche Verlängerung der Straße Altwilschdorf übertragen.

 Die Keulenbergstraße war ursprünglich Teil eines durch den Wilschdorfer Ortskern führenden Verbindungsweges von Dresden nach Moritzburg. Früher wurde er als Moritzburger Schlagweg bezeichnet. Um 1900 bürgerte sich umgangssprachlich die Bezeichnung Stadtweg ein, da diese Straße von den Wilschdorfern als Weg nach Dresden genutzt wurde. Mit der offiziellen Vergabe von Straßennamen bekam die Straße im Juni 1923 den Namen Dresdner Straße. Um Verwechslungen zu vermeiden, erfolgte im September 1953 die Umbenennung in Keulenbergstraße. Der Keulenberg ist ein beliebtes Ausflugsziel zwischen Pulsnitz und Königsbrück.
Die Keulenbergstraße war ursprünglich Teil eines durch den Wilschdorfer Ortskern führenden Verbindungsweges von Dresden nach Moritzburg. Früher wurde er als Moritzburger Schlagweg bezeichnet. Um 1900 bürgerte sich umgangssprachlich die Bezeichnung Stadtweg ein, da diese Straße von den Wilschdorfern als Weg nach Dresden genutzt wurde. Mit der offiziellen Vergabe von Straßennamen bekam die Straße im Juni 1923 den Namen Dresdner Straße. Um Verwechslungen zu vermeiden, erfolgte im September 1953 die Umbenennung in Keulenbergstraße. Der Keulenberg ist ein beliebtes Ausflugsziel zwischen Pulsnitz und Königsbrück.
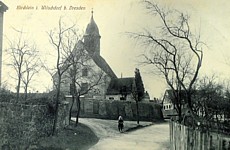 Die Kirchstraße ist die zweite Hauptstraße des Ortes Wilschdorf und verläuft parallel zur früheren Dorfstraße (Altwilschdorf), von der sie durch den Dorfbach getrennt ist. Zunächst wurde sie ab Juni 1923 Zweigstraße genannt, bereits drei Jahre später jedoch in Waldteichstraße umbenannt. Dieser Name ging 1933 jedoch auf eine andere Wilschdorfer Straße über. In diesem Zusammenhang erhielt die Kirchstraße ihren heutigen Namen. Dieser nimmt Bezug auf die 1242 erstmals erwähnte
Die Kirchstraße ist die zweite Hauptstraße des Ortes Wilschdorf und verläuft parallel zur früheren Dorfstraße (Altwilschdorf), von der sie durch den Dorfbach getrennt ist. Zunächst wurde sie ab Juni 1923 Zweigstraße genannt, bereits drei Jahre später jedoch in Waldteichstraße umbenannt. Dieser Name ging 1933 jedoch auf eine andere Wilschdorfer Straße über. In diesem Zusammenhang erhielt die Kirchstraße ihren heutigen Namen. Dieser nimmt Bezug auf die 1242 erstmals erwähnte 
 Die Straße Leeraue beginnt südlich des Wilschdorfer Dorfkerns, zweigt dort von der Keulenbergstraße ab und verläuft bis zum Waldgebiet Junge Heide an der Autobahn A4. Der bereits seit Jahrhunderten nachweisbare Weg erhielt seinen Namen vermutlich nach der "Leerhabener Tränke", einem Forstort in der Dresdner Heide. Von dieser Bezeichnung sind später mehrere Wegenamen wie Leerhabischer Weg, Lihrhab' scher Weg, Lehrhauischer Weg und Leerhawischer Weg abgeleitet worden. 1923 erfolgte die amtliche Bezeichnung des ausgebauten Abschnitts südlich der Saßnitzer Straße als Leeraue. Der nördliche Abschnitt bis zum Dorfkern wurde hingegen Stadtweg bzw. Boxdorfer Stadtweg genannt. Ein Teil dieses Weges gehörte dann zur Dresdner Straße (heute Keulenbergstraße), der übrige wurde zum Heideweg. 1933 wurde der Heideweg der Leeraue zugeschlagen.
Die Straße Leeraue beginnt südlich des Wilschdorfer Dorfkerns, zweigt dort von der Keulenbergstraße ab und verläuft bis zum Waldgebiet Junge Heide an der Autobahn A4. Der bereits seit Jahrhunderten nachweisbare Weg erhielt seinen Namen vermutlich nach der "Leerhabener Tränke", einem Forstort in der Dresdner Heide. Von dieser Bezeichnung sind später mehrere Wegenamen wie Leerhabischer Weg, Lihrhab' scher Weg, Lehrhauischer Weg und Leerhawischer Weg abgeleitet worden. 1923 erfolgte die amtliche Bezeichnung des ausgebauten Abschnitts südlich der Saßnitzer Straße als Leeraue. Der nördliche Abschnitt bis zum Dorfkern wurde hingegen Stadtweg bzw. Boxdorfer Stadtweg genannt. Ein Teil dieses Weges gehörte dann zur Dresdner Straße (heute Keulenbergstraße), der übrige wurde zum Heideweg. 1933 wurde der Heideweg der Leeraue zugeschlagen.
 Der heutige Lößnitzweg wurde früher als Sansenweg bezeichnet. "Kleine Sansen" und "Große Sansen" waren die Namen der hier gelegenen Flurstücke. Da dieser Weg in Richtung Oberlößnitz führte (heute ein Stadtteil von Radebeul) bürgerte sich Anfang des 20. Jahrhunderts der Name Oberlößnitzer Weg ein. 1923 erhielt er bei der erstmaligen amtlichen Benennung der Wilschdorfer Straßen den Namen Lößnitzstraße. Da es eine solche jedoch auch in der Leipziger Vorstadt gab, machte sich nach der Eingemeindung von Wilschdorf eine Namensänderung erforderlich. Im September 1953 entschied man sich für die Abwandlung in Lößnitzweg. Im oberen Teil zur Straße ausgebaut, ist er im weiteren Verlauf ein Waldweg durch die Junge Heide und endet am Augustusweg.
Der heutige Lößnitzweg wurde früher als Sansenweg bezeichnet. "Kleine Sansen" und "Große Sansen" waren die Namen der hier gelegenen Flurstücke. Da dieser Weg in Richtung Oberlößnitz führte (heute ein Stadtteil von Radebeul) bürgerte sich Anfang des 20. Jahrhunderts der Name Oberlößnitzer Weg ein. 1923 erhielt er bei der erstmaligen amtlichen Benennung der Wilschdorfer Straßen den Namen Lößnitzstraße. Da es eine solche jedoch auch in der Leipziger Vorstadt gab, machte sich nach der Eingemeindung von Wilschdorf eine Namensänderung erforderlich. Im September 1953 entschied man sich für die Abwandlung in Lößnitzweg. Im oberen Teil zur Straße ausgebaut, ist er im weiteren Verlauf ein Waldweg durch die Junge Heide und endet am Augustusweg.
 In der Nähe der Radeburger Straße in den Hellerbergen befand sich während des Zweiten Weltkriegs ab 1942 ein
In der Nähe der Radeburger Straße in den Hellerbergen befand sich während des Zweiten Weltkriegs ab 1942 ein 
 Der Reineckeweg am östlichen Rand des Wilschdorfer Dorfkerns führt an der früheren Schule des Ortes vorbei (Foto links) und erhielt deshalb 1923 zunächst den Namen Schulstraße. Das noch vorhandene
Der Reineckeweg am östlichen Rand des Wilschdorfer Dorfkerns führt an der früheren Schule des Ortes vorbei (Foto links) und erhielt deshalb 1923 zunächst den Namen Schulstraße. Das noch vorhandene 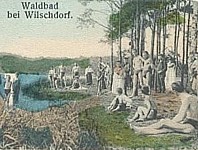 Die Waldteichstraße wurde Ende der 1920er Jahre im Zusammenhang mit der Errichtung einer Eigenheimsiedlung angelegt und im Februar 1930 An der Siedlung benannt. Ende 1945 beschloss der Gemeinderat die Umbenennung in August-Bebel-Straße (1840-1913). August Bebel war Arbeiterführer und Vorsitzender der SPD. Da es jedoch auch in Strehlen einer August-Bebel-Straße gab, machte sich nach der Eingemeindung eine erneute Umbenennung erforderlich. Dabei entschied man sich im September 1953 für den Namen Waldteichstraße. Dieser nimmt Bezug auf die nördlich von Wilschdorf gelegenen beiden Waldteiche (Foto).
Die Waldteichstraße wurde Ende der 1920er Jahre im Zusammenhang mit der Errichtung einer Eigenheimsiedlung angelegt und im Februar 1930 An der Siedlung benannt. Ende 1945 beschloss der Gemeinderat die Umbenennung in August-Bebel-Straße (1840-1913). August Bebel war Arbeiterführer und Vorsitzender der SPD. Da es jedoch auch in Strehlen einer August-Bebel-Straße gab, machte sich nach der Eingemeindung eine erneute Umbenennung erforderlich. Dabei entschied man sich im September 1953 für den Namen Waldteichstraße. Dieser nimmt Bezug auf die nördlich von Wilschdorf gelegenen beiden Waldteiche (Foto). Die Warnemünder Straße befindet sich im südlichen Teil des alten Wilschdorfer Dorfkerns. Bei der ersten Vergabe von Straßennamen erhielt sie 1923 zunächst die Bezeichnung Moritzburger Straße. Nach der Eingemeindung wechselte der Name im September 1953 in Warnemünder Straße, benannt nach einem Stadtteil von Rostock. Wie auch bei der Saßnitzer Straße und mehreren Straßen im benachbarten Klotzsche wählte man einen Ort an der Ostsee als Namensgeber. Markantestes Gebäude ist der frühere Dorfgasthof (Nr. 1). In der Nähe befindet sich ein ebenfalls unter Denkmalschutz stehender Trafoturm, der mit seiner originellen Bemalung an die Geschichte des Dorfes erinnert.
Die Warnemünder Straße befindet sich im südlichen Teil des alten Wilschdorfer Dorfkerns. Bei der ersten Vergabe von Straßennamen erhielt sie 1923 zunächst die Bezeichnung Moritzburger Straße. Nach der Eingemeindung wechselte der Name im September 1953 in Warnemünder Straße, benannt nach einem Stadtteil von Rostock. Wie auch bei der Saßnitzer Straße und mehreren Straßen im benachbarten Klotzsche wählte man einen Ort an der Ostsee als Namensgeber. Markantestes Gebäude ist der frühere Dorfgasthof (Nr. 1). In der Nähe befindet sich ein ebenfalls unter Denkmalschutz stehender Trafoturm, der mit seiner originellen Bemalung an die Geschichte des Dorfes erinnert.

