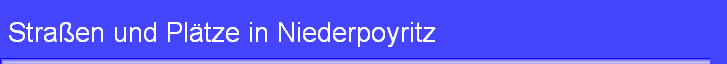 |
Villa Stolberg-Wernigerode: Die im Landhausstil gestaltete Villa entstand Ende des 19. Jahrhunderts am Elbhang und war ursprünglich nur über einen Treppenaufgang von der Pillnitzer Landstraße 197 erreichbar. Bis Mitte der Dreißiger Jahre diente sie als Sommersitz der Gräfin von Stolberg-Wernigerode. Danach wurden die Räume an mehrere Familien vermietet und während des Zweiten Weltkriegs als Flüchtlingsquartier genutzt. Am 13. Febuar 1945 zerstörte eine Luftmine die Villa, wobei sieben Menschen ums Leben kamen. Das großzügige Grundstück fiel 1946 unter die Bestimmungen der Bodenreform, wurde daraufhin parzelliert und an Kleingärtner verteilt.
Zu den bemerkenswertesten Gebäude der Eugen-Dieterich-Straße gehören die Anlagen des früheren Rittergutes, welche heute Wohnzwecken bzw. als Pension “Zur königlichen Ausspanne” dienen. Weitere Gebäude entstanden im 18./19. Jahrhundert als einfache Handwerker- und Häuslerwohnungen. Im Garten eines dieser Grundstücke erinnert eine kleine Sternwarte an den früheren Besitzer, einen Mitarbeiter von Carl Zeiss Jena.
Mehrfach wechselten die Eigentümer des Gutes, zu denen sächsische Militärs wie der kurfürstlich-sächsische Premier-Leutnant Johann Ernst Stiefel (1792-98) und kurfürstliche Beamte wie der Konferenzminister und Geheime Rat Carl Wilhelm von Carlowitz (1803/04) gehörten. 1810 erwarb Elisabeth Maria Magdalena von Olsusieff gemeinsam mit ihrem Mann das Rittergut. 1827 verkauften sie ihren Besitz an Kronprinz Friedrich August (später König Friedrich August II.). Unter seiner Regie erfolgten zahlreiche Erweiterungen und Neubauten. Verschiedene Wappentafeln und Schlusssteine an den erhaltenen Nebengebäuden der Schlossvilla erinnern noch an diese Zeit.
Ursprünglich gehörte zum Herrenhaus auch ein nur noch in Fragmenten erhaltener Park. In einem der dort errichteten Gebäude befand sich einst die Kunstglaserei Schramm. Nach 1945 wurde außerdem eine Baracke errichtet, welche lange Zeit einen Kindergarten beherbergte.
Die Moosleite, früher auch als Moosleitenweg bzw. Communaler Fußweg nach Pappritz bezeichnet, verbindet die Pillnitzer Landstraße mit dem oberhalb des Elbhangs gelegenen Ort Pappritz und ist gleichzeitig wichtiger Verbindungsweg vom Hochland zur Elbfähre. Ihren Namen erhielt sie nach einem hier zu Tal fließenden kleinen Bach. Der nur wenige hundert Meter lange Bach entspringt am Südrand von Pappritz am Mieschenhang und mündet unmittelbar unterhalb der Pillnitzer Landstraße unterirdisch in die Elbe. Im Zuge der Bebauung des oberen Abschnitts wurde er in den 1990er Jahren auf Pappritzer Flur offiziell Moosleite genannt. 1921 entstand an der Moosleite (ehem. Nr. 60, heute Nr. 1) das Wohnhaus des Architekten Kurt Bärbig (1889-1968). Bärbig besuchte die Städtische Gewerbeschule und die Baugewerkeschule und arbeitete ab 1913 als freischaffender Architekt. Sein Büro befand sich in der Pirnaischen Vorstadt (Marschallstraße 12, Wallotstraße 24, Viktoriastraße 8). Bekannt wurde er durch seine Planungen für den sozialen Wohnungsbau und gewerkschaftsnahe Bauvorhaben wie u.a. das Volkshaus Cotta, die Konsum-Fleischverarbeitungsfabrik auf der Fabrikstraße und die Wohnsiedlung der Siedlungsstraße in Niederpoyritz. Wegen seiner SPD-Mitgliedschaft wurde er 1933 mit Berufsverbot belegt und wanderte nach Brasilien aus. Nach seiner Rückkehr bezog er wieder sein selbst entworfenes Haus in Pappritz. Bärbigs Grab befindet sich auf dem Hosterwitzer Friedhof. Der im 19. Jahrhundert als Steinweg bzw. Staffelweg bezeichnete Verbindungsweg nach Pappritz erhielt 1902 offiziell seinen heutigen Namen Pappritzer Weg. Mit dem Bau der Staffelsteinstraße 1902 wurde er jedoch teilweise überbaut und im oberen Abschnitt als Treppe ausgeführt. Im unteren Teil sind noch mehrere historische Gebäude aus der Vergangenheit des Dorfes Niederpoyritz erhalten.
Foto: Wohnhäuser am Pappritzer Weg um 1910 Der gegenüber dem Oberen Gasthof in Richtung Elbe führende Weg trug ursprünglich den Namen Schulstraße, da sich hier das 1896 eröffnete Niederpoyritzer Schulhaus befand. Um Verwechslungen mit einer gleichnamigen Straße in Coschütz zu vermeiden, erfolgte 1950 die Umbenennung in Plantagenweg. Zu den erhaltenen Wohngebäuden der Straße gehört auch das einstige Gemeindearmenhaus (Nr. 2).
Nach 1900 wurden die an der Rockauer Straße gelegenen Grundstücke mit villenartigen Wohnhäusern bebaut. Eigentümer waren u.a. der Brauereibesitzer Clausnitzer (Schlossbrauerei Niederpoyritz) und der Kunstmaler Max Pietzschmann (1865-1952). Pietzschmann war Professor an der Kunstakademie und gehörte zum “Goppelner Kreis”, einer Vereinigung von Landschaftsmalern. 1929 entstand an der Rockauer Straße ein von der Nieskyer Firma Christoph & Unmack gebautes Holzhaus. Weitere Wohnhäuser folgten in den Dreißiger Jahren.
Die Gebäude der Siedlungsstraße wurden ab 1924 für die “Siedlergemeinschaft Niederpoyritz” errichtet. Die Planungen oblagen dem Architekten Kurt Bärbig, der für das Grundstück mehrere der Hanglage angepasste Doppelhäuser entwarf. Ursprünglich war neben den Wohnhäusern auch ein gemeindeeigenes Verwaltungsgebäude vorgesehen. An dessen Stelle entstand wenig später das neue Feuerwehrhaus. Erst 1939 konnte das Bauvorhaben abgeschlossen werden. Noch bis zum Ersten Weltkrieg gab es an Stelle der heutigen Staffelsteinstraße lediglich einen schmalen und schwer befahrbaren Weg, welcher vom Elbtal nach Pappritz führte. Wegen seines schlechten Bauzustandes entschied sich die Gemeinde Niederpoyritz nach längerer Diskussion zum Ausbau zur Straße. Nach dem Ankauf der benötigten Grundstücke wurde Anfang 1914 mit den Arbeiten begonnen. Dafür musste auf einer Länge von ca. 700 Metern das Straßenfundament neu angelegt und befestigt werden. Hinzu kamen Stützmauern und wegen des komplizierten Geländeprofils notwendige Befestigungen. Die Fertigstellung der neuen Straße erfolgte noch im August des gleichen Jahres. Zunächst wurde sie Bergstraße, ab 1930 nach dem hier befindlichen Gasthaus “Staffelstein” Staffelsteinstraße genannt.
Ältestes Gebäude ist das frühere Gasthaus “Staffelstein”, welches wegen seiner herrlichen Fernsicht einst beliebtes Ausflugsziel war, heute jedoch nur noch als Wohngebäude dient. Weitere Wohnhäuser entstanden nach dem Ersten Weltkrieg. Bemerkenswert sind drei in den Dreißiger Jahren errichtete Holzhäuser der bayrischen Firma Isartaler Holzhaus- Bau G.m.b.H. Initiiert wurden diese von deren Generalvertreter für Sachsen Würffel, der mit seiner Familie selbst eines der Gebäude bewohnte. Am früheren Atelierhaus des Malers Hanns Herzing (1890-1971) erinnert eine Gedenktafel an den Künstler (Foto) .
“Unser schönes Sachsenland ist als reizend weltbekannt. Die Gaststätte blieb auch nach 1945 zunächst geöffnet und existierte bis um 1975. Danach wurde das Gebäude zu einer Pension umgebaut. Heute dient es als Wohnhaus. Nr. 10: Das Wohnhaus entstand kurz nach der Jahrhundertwende und gehörte dem Senftenberger Braunkohlefabrikanten Lindemann. Ebenso wie einige weitere Gebäude in der Nachbarschaft wurde die Villa beim Luftangriff am 13./14. Februar 1945 schwer beschädigt und brannte aus. In der Nachkriegszeit erfolgte der Wiederaufbau in vereinfachter Form. Der Wohnweg wurde 1928 durch die Gemeinde Niederpoyritz als Wohnstraße E projektiert und sollte ab 1937 zur Straße ausgebaut werden, was jedoch nie erfolgte. Die offizielle Namensgebung stammt aus der Zeit um 1950. In seinem Verlauf geht er auf einen alten Botenweg durch die Weinberge zurück, welcher im 18. Jahrhundert die Besitzungen der Wettiner in Pillnitz und Moritzburg verband. Am Wohnweg sind noch einige Reste einstiger Weinbergsmauern zu finden. Bemerkenswert war ein um 1800 errichtetes Weinberghäuschen mit Fachwerk, welches leider nach 1945 verfiel und um 1975 dem Abbruch verfiel. Ursprünglich gehörte es zum Gierthschen Weinberg, dessen Stammhaus das Grundstück Pillnitzer Landstraße 254 war. |
| [Home] [Nord] [Nordwest] [Neustadt] [Nordost] [West] [Zentrum] [Südwest] [Süd] [Südost] [Ost] [Register] [Kontakt] [Impressum] |

 Die Straße Am Friedenshang entstand 1934 im Zuge der Erschließung eines geplanten
neuen Wohngebietes zwischen Niederpoyritz und Wachwitz, welches jedoch kriegsbedingt nur teilweise realisiert wurde. Ursprünglich trug sie den Namen Wohnstraße F. Das hier
gelegene Grundstück befand sich bis nach dem Zweiten Weltkrieg im Besitz der Gräfin von Stolberg-Wernigerode. Nach Enteigung des Areals begann 1946 der Ausbau des Weges,
welcher 1949 auf Wunsch der Anwohner den Namen “Am Friedenshang” erhielt. Am Anfang der Straße befindet sich eine kleine Grünanlage, von welcher sich ein wunderschöner Blick über das Elbtal bietet (Foto)
. Die vom städtischen Grünflächenamt angelegte und mit Ruhebänken versehene Fläche diente zuvor als Schutthalde des Ortes.
Die Straße Am Friedenshang entstand 1934 im Zuge der Erschließung eines geplanten
neuen Wohngebietes zwischen Niederpoyritz und Wachwitz, welches jedoch kriegsbedingt nur teilweise realisiert wurde. Ursprünglich trug sie den Namen Wohnstraße F. Das hier
gelegene Grundstück befand sich bis nach dem Zweiten Weltkrieg im Besitz der Gräfin von Stolberg-Wernigerode. Nach Enteigung des Areals begann 1946 der Ausbau des Weges,
welcher 1949 auf Wunsch der Anwohner den Namen “Am Friedenshang” erhielt. Am Anfang der Straße befindet sich eine kleine Grünanlage, von welcher sich ein wunderschöner Blick über das Elbtal bietet (Foto)
. Die vom städtischen Grünflächenamt angelegte und mit Ruhebänken versehene Fläche diente zuvor als Schutthalde des Ortes.  Die Eugen-Dietrich-Straße hat ihren Ausgangspunkt am Dorfplatz und führt von dort
zum Helfenberger Grund und weiter nach Helfenberg. Im Zusammenhang mit ihrem Ausbau 1909 erhielt sie ihren Namen nach dem Unternehmer Eugen Dieterich (1840-1904). Dieterich war Gründer der
Die Eugen-Dietrich-Straße hat ihren Ausgangspunkt am Dorfplatz und führt von dort
zum Helfenberger Grund und weiter nach Helfenberg. Im Zusammenhang mit ihrem Ausbau 1909 erhielt sie ihren Namen nach dem Unternehmer Eugen Dieterich (1840-1904). Dieterich war Gründer der  Herrenhaus: Das Herrenhaus Niederpoyritz, später auch als Schlossvilla bezeichnet, entstand 1735 als Sitz eines neu gebildeten Rittergutes, zu welchem
Flächen in Niederpoyritz und im benachbarten Wachwitz gehörten. Wirtschaftliches Rückgrat war neben dem Weinbau vor allem die zugehörige
Herrenhaus: Das Herrenhaus Niederpoyritz, später auch als Schlossvilla bezeichnet, entstand 1735 als Sitz eines neu gebildeten Rittergutes, zu welchem
Flächen in Niederpoyritz und im benachbarten Wachwitz gehörten. Wirtschaftliches Rückgrat war neben dem Weinbau vor allem die zugehörige  Mit dem Tod des Königs wurde das Niederpoyritzer Rittergut 1854 mit allen
zugehörigen Liegenschaften verkauft. Die Schlossvilla diente fortan als Wohnhaus. Ab 1929 gab es hier die Landweinschänke “Schloß Poyritz”, welche jedoch wenige Jahre
später mangels Zuspruchs wieder geschlossen wurde. 1985 wurde das zuletzt als Wohnhaus genutzte baufällige Gebäude weitgehend abgerissen. Heute erinnern nur noch zwei erhaltene Außenwände an die einstige Villa (Foto)
. 1997 entstand auf dem Areal ein Neubau.
Mit dem Tod des Königs wurde das Niederpoyritzer Rittergut 1854 mit allen
zugehörigen Liegenschaften verkauft. Die Schlossvilla diente fortan als Wohnhaus. Ab 1929 gab es hier die Landweinschänke “Schloß Poyritz”, welche jedoch wenige Jahre
später mangels Zuspruchs wieder geschlossen wurde. 1985 wurde das zuletzt als Wohnhaus genutzte baufällige Gebäude weitgehend abgerissen. Heute erinnern nur noch zwei erhaltene Außenwände an die einstige Villa (Foto)
. 1997 entstand auf dem Areal ein Neubau. 
 Der im Volksmund nach seinem Verlauf zur Gaststätte
Der im Volksmund nach seinem Verlauf zur Gaststätte 
 Die heutige Rockauer Straße geht auf einen alten Verbindungsweg zurück, welcher vom Elbtal hinauf zur Rockauer Höhe führte. Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Straße
ausgebaute Abschnitt wurde ab 1916 Hans-Dieterich-Straße genannt. Mit dieser Namensgebung sollte an den Sohn Eugen Dieterichs, den langjährigen kaufmännischen
Direktor der Chemischen Fabrik Helfenberg Hans Dieterich erinnert werden, der auch selbst an dieser Straße wohnte. Da es jedoch immer wieder zu Verwechslungen mit der
benachbarten Eugen-Dieterich-Straße gab, entschloss sich der Gemeinderat 1930 zur Rückbenennung in Rockauer Straße.
Die heutige Rockauer Straße geht auf einen alten Verbindungsweg zurück, welcher vom Elbtal hinauf zur Rockauer Höhe führte. Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Straße
ausgebaute Abschnitt wurde ab 1916 Hans-Dieterich-Straße genannt. Mit dieser Namensgebung sollte an den Sohn Eugen Dieterichs, den langjährigen kaufmännischen
Direktor der Chemischen Fabrik Helfenberg Hans Dieterich erinnert werden, der auch selbst an dieser Straße wohnte. Da es jedoch immer wieder zu Verwechslungen mit der
benachbarten Eugen-Dieterich-Straße gab, entschloss sich der Gemeinderat 1930 zur Rückbenennung in Rockauer Straße. Die Siedlungsstraße entstand Anfang der Zwanziger Jahre im Zuge der Erschließung des
Gebietes für die Wohnbebauung. Zuvor gehörte das Areal oberhalb der Pillnitzer Landstraße 221 zur fiskalischen Weinbergsdomäne. Zunächst wurde sie als Wohnstraße
D bezeichnet und bis 1926 im Rahmen von “Notstandsarbeiten” schrittweise ausgebaut. 1927 erfolgte die inoffizielle, im März 1930 die amtliche Benennung in Siedlungsstraße.
Die Siedlungsstraße entstand Anfang der Zwanziger Jahre im Zuge der Erschließung des
Gebietes für die Wohnbebauung. Zuvor gehörte das Areal oberhalb der Pillnitzer Landstraße 221 zur fiskalischen Weinbergsdomäne. Zunächst wurde sie als Wohnstraße
D bezeichnet und bis 1926 im Rahmen von “Notstandsarbeiten” schrittweise ausgebaut. 1927 erfolgte die inoffizielle, im März 1930 die amtliche Benennung in Siedlungsstraße.  1945 richteten Bombenabwürfe Schäden an der Straßenbefestigung und den Stützmauern an.
Mehrfach kam es auch zu Unwetterschäden, u.a. 1932, 1967 und 1995. Diese waren Anlass zur Kanalisierung des Bachbettes und zur Anlage eines Hochwasserrückhaltebeckens an der Flurgrenze
zwischen Niederpoyritz und Helfenberg. Ein von der Stadtverwaltung 2002 geplanter Ausbau der Staffelsteinstraße wurde von einer Bürgerinitiative erfolgreich verhindert.
1945 richteten Bombenabwürfe Schäden an der Straßenbefestigung und den Stützmauern an.
Mehrfach kam es auch zu Unwetterschäden, u.a. 1932, 1967 und 1995. Diese waren Anlass zur Kanalisierung des Bachbettes und zur Anlage eines Hochwasserrückhaltebeckens an der Flurgrenze
zwischen Niederpoyritz und Helfenberg. Ein von der Stadtverwaltung 2002 geplanter Ausbau der Staffelsteinstraße wurde von einer Bürgerinitiative erfolgreich verhindert. Gasthaus Staffelstein:
Die Ausflugsgaststätte wurde Ende des 19. Jahrhunderts auf einem früheren Weinbergsgrundstück errichtet und war wegen ihrer reizvollen Lage und der guten Fernsicht weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Bis zur
Fertigstellung der Staffelsteinstraße konnte der Aufstieg nur über einen schmalen Fußweg und mehrere Treppen erfolgen. Regelmäßig kehrten hier auch Künstler und
die Mitglieder von Gesangsvereinen ein, was zur Entstehung zahlreicher Gedichte und Lieder über das Lokal führte und zu dessen Popularität beitrug:
Gasthaus Staffelstein:
Die Ausflugsgaststätte wurde Ende des 19. Jahrhunderts auf einem früheren Weinbergsgrundstück errichtet und war wegen ihrer reizvollen Lage und der guten Fernsicht weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Bis zur
Fertigstellung der Staffelsteinstraße konnte der Aufstieg nur über einen schmalen Fußweg und mehrere Treppen erfolgen. Regelmäßig kehrten hier auch Künstler und
die Mitglieder von Gesangsvereinen ein, was zur Entstehung zahlreicher Gedichte und Lieder über das Lokal führte und zu dessen Popularität beitrug: