|
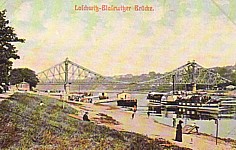 Bereits im Jahr 1430 wurde in Loschwitz der erste Elbübergang erwähnt, der in einer Fähre zum gegenüberliegenden Dorf Blasewitz bestand. Der Übergang gehörte zu den wichtigsten im Stadtgebiet und unterstand deshalb ab 1723 dem Amt Dresden. Die Fährgerechtigkeit befand sich im Besitz verschiedener Loschwitzer Familien, die im heute noch erhaltenen Fährgut an der Friedrich-
Wieck-Straße 45 lebten. Wegen des starken Verkehrs wurde bereits um 1870 der Bau einer Brücke an dieser Stelle erwogen. Eine entsprechende Petition der Anliegergemeinden unter Führung des Loschwitzer Gemeindevorstandes Moritz Strauß lehnte der sächsische Landtag 1883 jedoch ab. Bereits im Jahr 1430 wurde in Loschwitz der erste Elbübergang erwähnt, der in einer Fähre zum gegenüberliegenden Dorf Blasewitz bestand. Der Übergang gehörte zu den wichtigsten im Stadtgebiet und unterstand deshalb ab 1723 dem Amt Dresden. Die Fährgerechtigkeit befand sich im Besitz verschiedener Loschwitzer Familien, die im heute noch erhaltenen Fährgut an der Friedrich-
Wieck-Straße 45 lebten. Wegen des starken Verkehrs wurde bereits um 1870 der Bau einer Brücke an dieser Stelle erwogen. Eine entsprechende Petition der Anliegergemeinden unter Führung des Loschwitzer Gemeindevorstandes Moritz Strauß lehnte der sächsische Landtag 1883 jedoch ab.
 Erst die Vorlage eigener Baupläne durch wohlhabende Blasewitzer Bürger brachten den Brückenbau wieder ins Gespräch. 1885 entstand ein Brückenbauverein, dem es gelang, drei Jahre später die Zustimmung des Landtags und der sächsischen Regierung zu erhalten. Man entschied sich für den Bau einer Hängebrücke in Stahlfachwerkkonstruktion zwischen dem Dorfplatz Blasewitz und dem gegenüberliegenden Loschwitz. Für den Brückenbau, der am 28. April 1891 begann, mussten verschiedene Gebäude auf beiden Elbseiten abgetragen werden. Mit dem Schillerplatz und dem Körnerplatz wurden die Brückenköpfe nach Fertigstellung des Bauwerks völlig neu gestaltet. Die Spannweite zwischen beiden Pfeilern beträgt 141,5 m bei einer Gesamtlänge von 260 Metern. Die Baukosten in Höhe von 2,25 Millionen Reichsmark übernahm zu zwei Dritteln der Staat; den Rest mussten die beiden Anliegergemeinden selbst aufbringen. Angefertigt wurden die meisten Eisenteile in der Königin-Marienhütte Zwickau-Cainsdorf, die mit dem “Blauen Wunder” ihren 1500. Brückenbau realisieren konnte. Erst die Vorlage eigener Baupläne durch wohlhabende Blasewitzer Bürger brachten den Brückenbau wieder ins Gespräch. 1885 entstand ein Brückenbauverein, dem es gelang, drei Jahre später die Zustimmung des Landtags und der sächsischen Regierung zu erhalten. Man entschied sich für den Bau einer Hängebrücke in Stahlfachwerkkonstruktion zwischen dem Dorfplatz Blasewitz und dem gegenüberliegenden Loschwitz. Für den Brückenbau, der am 28. April 1891 begann, mussten verschiedene Gebäude auf beiden Elbseiten abgetragen werden. Mit dem Schillerplatz und dem Körnerplatz wurden die Brückenköpfe nach Fertigstellung des Bauwerks völlig neu gestaltet. Die Spannweite zwischen beiden Pfeilern beträgt 141,5 m bei einer Gesamtlänge von 260 Metern. Die Baukosten in Höhe von 2,25 Millionen Reichsmark übernahm zu zwei Dritteln der Staat; den Rest mussten die beiden Anliegergemeinden selbst aufbringen. Angefertigt wurden die meisten Eisenteile in der Königin-Marienhütte Zwickau-Cainsdorf, die mit dem “Blauen Wunder” ihren 1500. Brückenbau realisieren konnte.
Konstrukteure der neuen Elbbrücke waren der Ingenieur Prof. Dr. Claus Köpcke und Bauinspektor Hans Manfred Krüger, die eine auf zwei Pylonen gelagerte Hängebrücke ohne Strompfeiler errichteten und damit einen der ersten Brückenbauten dieser Art in Europa schufen. Wegen der kühnen Konstruktion und des blau-grünen Farbanstrichs wurde die neue Elbbrücke im Volksmund bald als “Blaues Wunder” bezeichnet.
 Nach einem erfolgreich verlaufenen Belastungstest mit drei Dampfwalzen, drei mit Steinen beladenen Straßenbahnloren und schweren Wassertankwagen am 11. Juli 1893 konnten die verantwortlichen Experten das Bauwerk abnehmen. Selbst eine Schützenkompanie der sächsischen Armee ließ man im Gleichschritt über die Brücke marschieren, um eventuelle Senkungen oder Verschiebungen messen zu können. Offiziell erhielt die am 15. Juli 1893 dem öffentlichen Verkehr übergebene Brücke den Namen König-Albert-Brücke, der nach der Eingemeindung beider Orte 1921 in Loschwitzer Brücke verändert wurde. Mit der Fertigstellung des Baus wurdeauch die bereits nach Blasewitz verkehrende elektrische Straßenbahn bis zum Körnerplatz und später bis nach Pillnitz verlängert. Nicht nur die Straßenbahnfahrgäste, sondern alle Nutzer der Brücke mussten in den ersten Jahren Brückenzoll errichten, wofür an beiden Enden Zollhäuschen entstanden. Erst 1921 wurde diese Brückengeldpflicht, die zeitweise bis zu 100.000 Mark im Jahr einbrachte, aufgehoben. Für Fahrzeuge endete sie sogar erst am 1. Juni 1924. Die beiden Zollhäuschen an den Brückenköpfen fielen dem Umbau 1935 zum Opfer. Nach einem erfolgreich verlaufenen Belastungstest mit drei Dampfwalzen, drei mit Steinen beladenen Straßenbahnloren und schweren Wassertankwagen am 11. Juli 1893 konnten die verantwortlichen Experten das Bauwerk abnehmen. Selbst eine Schützenkompanie der sächsischen Armee ließ man im Gleichschritt über die Brücke marschieren, um eventuelle Senkungen oder Verschiebungen messen zu können. Offiziell erhielt die am 15. Juli 1893 dem öffentlichen Verkehr übergebene Brücke den Namen König-Albert-Brücke, der nach der Eingemeindung beider Orte 1921 in Loschwitzer Brücke verändert wurde. Mit der Fertigstellung des Baus wurdeauch die bereits nach Blasewitz verkehrende elektrische Straßenbahn bis zum Körnerplatz und später bis nach Pillnitz verlängert. Nicht nur die Straßenbahnfahrgäste, sondern alle Nutzer der Brücke mussten in den ersten Jahren Brückenzoll errichten, wofür an beiden Enden Zollhäuschen entstanden. Erst 1921 wurde diese Brückengeldpflicht, die zeitweise bis zu 100.000 Mark im Jahr einbrachte, aufgehoben. Für Fahrzeuge endete sie sogar erst am 1. Juni 1924. Die beiden Zollhäuschen an den Brückenköpfen fielen dem Umbau 1935 zum Opfer.
 Obwohl das “Blaue Wunder” durchaus modernen Verkehrserfordernissen entsprechend projektiert worden war, mussten bereits 1935 Veränderungen an der Brücke vorgenommen werden. Zu beiden Seiten wurden Gangbahnen für Fußgänger angebaut, so dass die Fahrbahn auf 10 Meter verbreitert werden konnte. Diese Maßnahmen verhinderten den ebenfalls erwogenen kompletten Neubau der Brücke als moderne Eisenbetonbrücke. Für Aufsehen sorgte kurze Zeit später der Kunstflieger Ernst Udet, der bei seinem Besuch des “Dresdner Flugtages” am 7. Juli 1935 mit seiner Maschine unter der Brücke hindurchflog. Obwohl das “Blaue Wunder” durchaus modernen Verkehrserfordernissen entsprechend projektiert worden war, mussten bereits 1935 Veränderungen an der Brücke vorgenommen werden. Zu beiden Seiten wurden Gangbahnen für Fußgänger angebaut, so dass die Fahrbahn auf 10 Meter verbreitert werden konnte. Diese Maßnahmen verhinderten den ebenfalls erwogenen kompletten Neubau der Brücke als moderne Eisenbetonbrücke. Für Aufsehen sorgte kurze Zeit später der Kunstflieger Ernst Udet, der bei seinem Besuch des “Dresdner Flugtages” am 7. Juli 1935 mit seiner Maschine unter der Brücke hindurchflog.
 1945 sollte die Loschwitzer Brücke wie alle Dresdner Elbübergänge gesprengt werden, um den Vormarsch der Roten Armee zu stoppen. Die Sprengkörper waren bereits angebracht und die Kabel verlegt worden. Der mutige Einsatz des Dresdner Telegrafenarbeiters Paul Zickler und des Klempnermeisters Erich Stöckel, die wenige Stunden vor Kriegsende unabhängig voneinander die Sprengdrähte durchschnitten, retteten das “Blaue Wunder” vor der Zerstörung. An beide erinnert seit dem 4. Mai 1965 eine Gedenktafel am Blasewitzer Brückenkopf. Weitere Retter der Brücke, wie der aus Rochwitz stammende Max Mühle, der Blasewitzer Handelsvertreter Carl Bouché und der als Brückenkommandant eingesetzte Hauptmann Wirth, sind heute weniger bekannt, waren aber ebenfalls an der Verhinderung der Sprengung beteiligt. 1945 sollte die Loschwitzer Brücke wie alle Dresdner Elbübergänge gesprengt werden, um den Vormarsch der Roten Armee zu stoppen. Die Sprengkörper waren bereits angebracht und die Kabel verlegt worden. Der mutige Einsatz des Dresdner Telegrafenarbeiters Paul Zickler und des Klempnermeisters Erich Stöckel, die wenige Stunden vor Kriegsende unabhängig voneinander die Sprengdrähte durchschnitten, retteten das “Blaue Wunder” vor der Zerstörung. An beide erinnert seit dem 4. Mai 1965 eine Gedenktafel am Blasewitzer Brückenkopf. Weitere Retter der Brücke, wie der aus Rochwitz stammende Max Mühle, der Blasewitzer Handelsvertreter Carl Bouché und der als Brückenkommandant eingesetzte Hauptmann Wirth, sind heute weniger bekannt, waren aber ebenfalls an der Verhinderung der Sprengung beteiligt.
Inschrift am Blasewitzer Brückenkopf der Loschwitzer Brücke
 Infolge technischen Verschleißes durch die ständig zunehmende Verkehrsbelastung mussten mehrfach Erneuerungsarbeiten an der Elbbrücke vorgenommen werden. So wurde 1956/59 der Holzbohlenbelag der Fahrbahn gegen Eisenblech ausgetauscht. 1982/85 erfolgte eine komplette Sanierung der Ankerkammern. Da Messungen eine zu starke Belastung der Brücke durch den Straßenbahnverkehr feststellten, wurde dieser am 10. April 1985 eingestellt (Foto: Bundesarchiv / Wikipedia). Auch die Nutzung des “Blauen Wunders” durch schwere LKW ist mittlerweile verboten. Regelmäßige Wartungsarbeiten sollen jedoch den Erhalt des Technischen Denkmals sichern. Ende 2011 konnte eine Lichtanstallation zur nächtlichen Beleuchtung der Brücke in Betrieb genommen werden. Infolge technischen Verschleißes durch die ständig zunehmende Verkehrsbelastung mussten mehrfach Erneuerungsarbeiten an der Elbbrücke vorgenommen werden. So wurde 1956/59 der Holzbohlenbelag der Fahrbahn gegen Eisenblech ausgetauscht. 1982/85 erfolgte eine komplette Sanierung der Ankerkammern. Da Messungen eine zu starke Belastung der Brücke durch den Straßenbahnverkehr feststellten, wurde dieser am 10. April 1985 eingestellt (Foto: Bundesarchiv / Wikipedia). Auch die Nutzung des “Blauen Wunders” durch schwere LKW ist mittlerweile verboten. Regelmäßige Wartungsarbeiten sollen jedoch den Erhalt des Technischen Denkmals sichern. Ende 2011 konnte eine Lichtanstallation zur nächtlichen Beleuchtung der Brücke in Betrieb genommen werden.
 Die Brücke gehört wegen ihres ungewöhnlichen Aussehens zu den Wahrzeichen Dresdens und war deshalb ein beliebtes Motiv für Künstler. Bekannte Darstellungen des “Blauen Wunders” schufen u. a. der Fotograf August Kotzsch sowie die Maler Max Ackermann (1908), Ernst Hassebrauk (1939) und Bernhard Kretzschmar (1954). 2000 war die Loschwitzer Elbbrücke Motiv einer Sonderbriefmarke der Deutschen Post (Bild). Die Brücke gehört wegen ihres ungewöhnlichen Aussehens zu den Wahrzeichen Dresdens und war deshalb ein beliebtes Motiv für Künstler. Bekannte Darstellungen des “Blauen Wunders” schufen u. a. der Fotograf August Kotzsch sowie die Maler Max Ackermann (1908), Ernst Hassebrauk (1939) und Bernhard Kretzschmar (1954). 2000 war die Loschwitzer Elbbrücke Motiv einer Sonderbriefmarke der Deutschen Post (Bild).
|
|